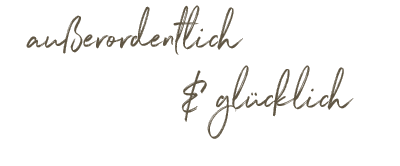Letzte Woche dauerte Tillis Schwimmstunde im Einzelunterricht gerade mal ganze 20 Minuten. Im Gang zu den Umkleiden übernehme ich einen sichtlich platten Tilli von einer ebenso ersichtlich geforderten Trainerin.
Letzte Woche dauerte Tillis Schwimmstunde im Einzelunterricht gerade mal ganze 20 Minuten. Im Gang zu den Umkleiden übernehme ich einen sichtlich platten Tilli von einer ebenso ersichtlich geforderten Trainerin.
„Puh!“ macht sie. Ich lache sie an, bis sie mitlachen muss. Die Anspannung kann für einen Moment weichen. „Er muss echt beginnen auf ‚STOPP‘ zu hören! Sonst geht das nicht.“
„Das wird nicht passieren“, entgegne ich völlig ruhig, klar und freundlich. Denn es ist ein Fakt, dass Tillis Weglauftendenz von einem starken Autonomiebedürfnis befeuert wird.
Und auch wenn Menschen im Außen schnell urteilen, dass wir dahingehend sicher nicht klar genug oder inkonsequent seien, ist es einfach eine Facette der Behinderung.
In unserem privaten Alltag ist die Weglauftendenz mittlerweile kaum noch vorhanden. Weil vorausschauendes Verhalten und Vertrauen das Übermaß an angstgetriebener Kontrolle abgelöst haben. Das machte Platz für Autonomie.
Zurück zu dem vollgefliesten Übergangsbereich von nass zu trocken. Ich sehe seine Trainerin an. Sie ist hin- und hergerissen. Wieder mal ein Moment in dem ich wirklich dankbar über meine Ausbildung bin. Und darüber verstanden zu haben, dass meine Offenheit Inklusion erst befähigen kann.
„Ich habe das Gefühl du hast Angst. Kann das sein?“ „Ja, Panik eher! Ich möchte hier kein Kind mit Platzwunde haben, weil es stürzt! Und er ist einfach unfassbar schnell.“
Ich lächle sie an. Sehe das Gefühlschaos über ihr Gesicht huschen. Angst, Wut, Traurigkeit und Scham.
Tilli kuschelt sich derweil mit seinen nassen Haaren an meinen Hals. Er hat keine Eile. Also lassen wir ihr Zeit. Nachdem sie durchgeatmet hat und überlegt, was sie sagen soll, spreche ich:
„Du darfst sagen, wenn es nicht geht. Das ist ok. Ich weiß, dass du mein Kind nicht ablehnst.“ Über ihr Gesicht huscht wieder die Scham und gleichzeitig Berührtsein. Es ist Zeit. Ich kann warten. Bis die Gedanken dahinter ausgesprochen werden können.
„Weißt du, ich habe tatsächlich noch nie mit Menschen mit dem Downsyndrom gearbeitet. Geschweige denn jemanden hier im Bad gesehen.“ Ich nicke. Kann es mir vorstellen.
„Aber ich sehe, dass er es kann. Er macht die Bewegung so gut. Nur das ‚nicht hören‘ macht mir echte Bauchschmerzen. Weil er einfach auch kein Risiko auslässt.“ Wieder nicke ich.
Es fällt mir leicht zu fühlen was sie fühlt. Viele Eltern von Kindern mit Behinderung kennen das. Die Zerissenheit zwischen Potenzial und dessen Ausschöpfung. Zwischen Förderung und Überforderung. Den Verlust der Leichtigkeit in der Beziehung.
„Weißt du, wie sehr ich zu schätzen weiß, dass du es überhaupt versuchst? Du bist mit so einer Offenheit und Neugier auf Tilli zu, das allein berührt mich sehr.
Es ist nur so, dass Tillmann schwimmen lernen muss! Weil es ein Gefahrenpotenzial ist, wie du richtig erkannt hast. Er ist uns bereits zweimal mit voller Montur und Absicht in einen See gelaufen. Einmal davon hatten wir einfach Glück, dass das Kind unserer Freunde es gesehen hat, während wir durch die anderen drei abgelenkt waren. Mein Mann und eine Freundin sind damals ins Wasser gerannt um ihn wieder hochzuziehen.“
Vor meinem inneren Auge sehe ich die Szene ablaufen, während Tillis Trainerin sichtlich geschockt ist.
„Wir haben derzeit keinen Therapeuten dafür an der Hand, doch das wird sich finden. Es ist wirklich ok, wenn du heute und hier entscheidest, dass es nicht geht. Ich weiß wieviel es abverlangt. Und du kannst auf keine Erfahrung zurückgreifen.“
„Ich will das wirklich gern machen, ich liebe meine Arbeit! Doch wenn das mit dem Weglaufen und ‚nicht hören’ so bleibt, ist es echt schwer.“ „Ja, das glaube ich dir“, sage ich und meine es auch so. Denn auch für uns war dieser Weg schwer. Auch wir haben es erst mit Tilli gelernt, was es heißt wirklich aufeinander zu achten und die Frustration auszuhalten, Dinge immer und immer wieder zu sagen.
„Andererseits will ich nicht einfach aufgeben!“ „Das kann ich sehen.“ Wir schweigen erneut einen Moment. Tilli zieht sich das Handtuch fester um die Schultern.
„Hör zu: was hältst du von der Idee, heute keine Entscheidung treffen zu müssen? Du überlegst es dir bis zum nächsten Schwimmtraining der Zwillinge und ein Nein ist ebenso willkommen wie ein Ja. Ist das ok für dich?“
Sie nickt. Der Stress und Druck fallen sichtlich von ihr ab. Das Ringen mit der Entscheidung bleibt noch ein wenig.
Tilli merkt, dass das Gespräch endet. Dreht sich auf meinem Arm zu ihr um. Drückt ihre Hand. „Tschüss!“, sagt er. Sie lächeln sich an. Haben einen guten Draht zueinander. Eine der besten Voraussetzungen. Jetzt fehlen nur noch Vertrauen, Sicherheit und Gelassenheit.
„Tschüss, Tilli“, sagt sie und streicht ihm über den nassen Hinterkopf.
Auf dem Heimweg merke ich, dass mir entgegen all dem Verständnis trotzdem das Herz schwer wird. Weil Inklusion von uns allen erfordert, in einer Welt die uns darauf trimmt funktional zu sein, zuzulassen, uns genau aus diesem Gefängnis starrer Erwartungen zu lösen.
Was sich wie Freiheit anfühlen müsste, kommt oft im Druck großer Verantwortung daher. Der Verantwortung es dem System so leicht wie möglich zu machen so starr und stupide zu bleiben wie es ist und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass es auch für die funktioniert, die nicht hineinpassen.
All die Gefühle in dieser jungen Frau zu sehen, die keine Berührungspunkte mit Menschen wie Tilli hat, berührt mich auf vielen Ebenen. Wie kann das sein? Es gibt so viele Kinder mit Downsyndrom in einem ähnlichen Alter im Landkreis. Wieso schlägt keins davon dort auf? Was wäre, wenn Kinder wie Tilli besser mitgedacht werden? Ist er dann wirklich ein Mehraufwand? Oder lernen Trainer vielleicht im Umgang mit allen Kindern dazu? Weil es eben nicht einzig und allein um Wissensvermittlung geht. Sondern um Beziehung. Zwischen Menschen. Für Menschen.
Als ich heute eine Woche später die Zwillinge ins Bad begleite, stehen wir im gleichen Gang, warten in der Gruppe eines ganz „normalen“ Kurses. Einem bei dem auch schon Kinder wieder gehen mussten, weil sie noch zu ängstlich oder mit zu wenig Konzentration ausgestattet waren. Funktionierte nicht im gewohnten Ablauf. Für Frida und Janosch ist es kein Problem, sie bewegen sich noch im zulässigen Toleranzbereich und finden den Kurs klasse.
Meinen Gedanken nachhängend geht mein Blick die grauen Fliesen ab, während meine Hände durch die Haare meiner Kinder wuscheln.
„Es ist okay“, denke ich, bin erwartungslos und habe meinen Frieden damit gemacht. Da öffnet sich die Tür zum Übungsbecken und unsere Trainerin kommt den Gang entlang. Sie begrüßt die Kinder und lässt ihren Blick auf mir ruhen, bis sie am Ende der Fliesen bei uns ankommt. „Ich mach‘s“, sagt sie und strahlt. Die Information hängt irgendwo vor mir fest. Mein Gesicht gibt vermutlich einen sehr überraschten Ausdruck zum Besten, bis ich zeitverzögert reagiere: „Echt?“ das noch immer strahlende Gesicht nickt. „Ja, ich habe mir überlegt, wie ich‘s machen kann und habe für mich zwei Ansätze. Das will ich gern ausprobieren.“ Wir schauen uns an. Lächeln beide. Haben uns schweigend darauf verschworen, den Toleranzbereich des Systems zu erweitern. „Und du weißt, dass du jederzeit sagen kannst, wenn es nicht geht?“ „Weiß ich“, sagt sie.
„Danke“, sage ich. „Dafür nicht“, will sie abwiegeln. Ich halte sie kurz am Arm fest, als sie mit den Kindern Richtung Übungsbecken ziehen will. „Doch. Genau dafür!“ und da ist es wieder das Gefühl, dass ich am liebsten in Gesichtern von Menschen sehe. Das Gefühl, welches wie Nordstern den Weg zu innerer Größe weist: Berührtsein.