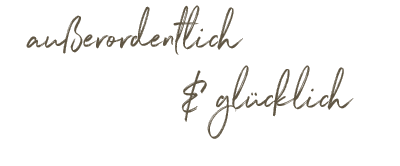Den Schritt zu wagen mich einer Therapeutin anzuvertrauen, war viel kleiner als ich ihn mir ausgemalt hatte. Ich wusste das alles in mir das brauchte. Jemand der mit mir hinschaut, aufräumt und mir dazu verhilft Dinge so sein zu lassen wie sie sind. Nein, nicht Dinge. Mich.
Der Entschluss fiel mit der Gewissheit, dass wir überraschend ein viertes Kind bekommen sollten. Er fiel mit dem inneren Kollaps, den ich verspürte. Am besten zu beschreiben mit einer Implosion, die mich auf mein Wesentliches reduzierte. Und so schmerzlich diese war, so sehr sie mich mit Ängsten, Scham und Traurigkeit traf, war sie genau das was es brauchte, um mich über mich selbst hinaus wachsen zu lassen. Über die innere Stimme, die mir sagte ich sei keine gute Mutter, keine gute Ehefrau, keine gute Freundin. Diese Stimme sagte über keinen meiner Anteile etwas gutes. Sie hielt mich für keinen guten Menschen. Sie war nicht einverstanden. Sie war enttäuscht. Ich hatte sie enttäuscht. Darüber gab es keinen Zweifel. Also begann ich mich aufzulösen in den roten Faden meiner eigenen Geschichte.
In meiner Kindheit hörte ich eine Aussage immer und immer wieder. „Nein, nicht so. Komm gib mal her, ich zeig dir wie das richtig geht!“ Im Anschluss wurde mir aus der Hand genommen, was ich offenkundig nicht hinbekommen konnte. Dieser Satz fiel in Situationen, die mir meist nicht einmal so wichtig erschienen. Weil ich einer Tätigkeit nachging, der ich nachgehen sollte. Wie ´etwas feines basteln´, ´ordentlich Schreibschrift üben´ oder ´filigran Häkeln´. Um genau zu sein: Filethäkeln. Am liebsten sollten Tischdeckchen umhäkelt werden. Mit filigranen Mustern entstand durch meiner eigener Hände Arbeit ein Bild aus einem einzigen langen Faden um ein Stück Stoff. Das Häkeln an sich machte mir total viel Spaß. Die Häkelschrift zu entziffern hatte etwas von Rätseln, und Masche um Masche etwas zu vervollständigen erinnerte mich ans puzzlen. Beides Dinge die ich von mir aus mochte. Und ich mochte es meiner Mutter zu gefallen. Für sie widerum war es schön, dass ich Gefallen an etwas fand, dass sie bereits von ihrer Mutter zu mögen gelernt hatte. Es war ein Garant für Aufmerksamkeit. Die galt es zu erlangen. Sie war meine Form von Liebe. Also häkelte ich Deckchen, die ich nicht schön fand, damit sie irgendwann ein Beistelltischchen schmücken sollten, welches niemand beachtete und meine Mutter und widerum deren Mutter hoffentlich stolz waren.
Da ich meine Sache gern machte, machte ich sie an sich gut. Jetzt ist gut aber nur das geringgeschätzte Geschwisterchen von perfekt. Wenn ich bei der Häkelschrift mal nicht weiterwusste, fragte ich, wie sie zu verstehen sei. „Zeig mal her!“, war der Anfang vom Ende eines Fadens der gnadenlos aufgeribbelt wurde, um dann behände selbst zu machen, wozu ich offensichtlich nicht im Stande war. Ich weiß noch, dass es mich anfangs traurig machte. Ich sagte es nicht. Denn es war ja mein Fehler. Außerdem wäre meinem aufbegehrenden ICH sonst unter schlechten Umständen die Aufmerksamkeit entzogen worden. Nach der durchgeführten Korrektur bekam ich alles wieder in die Hand gedrückt um weiterzumachen. Bitte ab jetzt fehlerfrei!
Irgendwann kannte ich die Zeichen der Häkelschriften. Ich verstand das System. ich musste nicht mehr fragen. Trotzdem machte ich ab und an Fehler. Ich erkannte sie selbst. Es wäre ein leichtes gewesen, sie in dem Moment als sie passierten einfach wieder aufzuribbeln und neu zu machen. Sie richtigzustellen. Ich tat es nicht immer. Ich rebellierte still gegen die abverlangte Perfektion, was bei kleineren Arbeiten auch niemandem auffiel. Doch die Sache ist die, wenn am Ende ein ausgeklügeltes Bild mit einer Kirche und Häusern rund um ein Stück Stoff entstehen soll, dann fällt es schwer diese Fehler dauerhaft nicht auffallen zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob ich wollte, dass sie es sieht. Habe ich insgeheim gehofft, dass sie meine Arbeit oder womöglich einfach die Zeit mit mir mehr wertschätzt als sie die Fehler in Aufruhr versetzten? Ja, ich denke schon. Ich war innerlich auf der Suche nach einer Liebe, die unabhängig von Aufmerksamkeit und Leistung war.
In der Vorweihnachtszeit, als ich meiner Erinnerung nach 8 oder 9 Jahre alt war, häkelte ich schon seit Wochen jeden Abend fleißig und still neben meiner Mutter. Es war ein aufwendiges Bild, dass ein sechseckiges Deckchen für meine Oma mit einem Dorf einfassen sollte. Ich erinnere mich daran, wie fein das Garn war. Wie ich immer wieder dazu angehalten wurde, die Maschen wirklich gleich groß zu machen. Immer den gleichen Zug auf dem Faden, immer die gleichen perfekten Bewegungen. Ich spürte den Druck, der auf mir lastete, weil das Deckchen als Geschenk mit in das Weihnachtspaket an Oma gelegt werden sollte. Und die Zeit rann mir im Fluss eines einzelnen Fadens ununterbrochen durch die häkelnden Hände. Immer wieder versuchte ich schneller zu werden, ganz zum Missfallen des Gesamtergebnisses, denn darunter litt die Ebenmäßigkeit der Maschen. Es strengte mich an. So sehr, dass es mir zuwider wurde. Die erhoffte Aufmerksamkeit war nur das fade Dabeiseindürfen. Ich wusste das und nahm es hin. Machte ich Fehler, sagte ich nichts und hoffte einfach, es würde im großen Netz, das ich sponn, untergehen.
Doch das ging nicht gut. Ich sah es selbst. Runde um Runde wirkten Fenster, Türpfosten und Kirchturmspitzen verzerrter. Da mir bewusst war, dass ich die Zeit nie aufholen konnte, wollte ich nichts sagen. Wenn es Zeit war ins Bett zu gehen, faltete ich das Deckchen still und ordentlich so zusammen, dass all das was ich bereits wusste und sehen konnte, nur mir auffiel. Ich hoffte inständig einem großen Donnerwetter zu entgehen, dass ich schon lautstark grollen hörte. Es war aus heutiger Sicht unfassbar irrational. Es war die Art von Hoffnung, das Schlechtes ungeschehen gemacht werden kann, wenn man nur fest genug daran glaubt, die man als Kind noch inne hat.
Als ich eines abends frisch gebadet im Nachthemd ins Wohnzimmer kam, um mich in meine Ecke zu kuscheln und aller Sinnhaftigkeit zum Trotz weiter zu häkeln, war mein Deckchen fort. Verblüfft schaute ich zu meiner Mutter, die ihrerseits hochkonzentriert an ihrem Werk arbeitete. Ich wusste, dass es keinen Grund gab anzunehmen, dass sie nicht wisse was los sei. Mein Herz rutschte mir in den rosanen Saum meines frisch gewaschenen und gebügelten Nachthemds. In der immerwährenden Handbewegung meiner Mutter sah ich die große Anspannung, die in ihr war. Die Wut und Enttäuschung über die Fehler in der Matrix. Barfüßig leise ging ich auf meinen Platz. Ich zog die Knie unter mein Kinn, dehnte mein Nachthemd darüber und umschloss mich mit meinen eigenen Armen. Ich machte mich sturmfest.
Stumm legte sie ihrerseits ihre Handarbeit zur Seite und holte aus ihrem Korb mein Deckchen. Wortlos faltete sie es auseinander. Wir wussten beide, dass das verzerrte Dörfchen zum Vorschein kommen würde. Sie nahm die Häkelnadel aus dem Garnknäuel und löste sie aus der letzten Masche, um sie ordentlich im Korb zu verstauen. Und dann sah ich zu, wie sie Masche um Masche aufribbelte und das Garn wieder auf das Knäuel aufwickelte. Das sich auflösende Gesamtwerk wurde wieder zum einzelnen Faden, der kraus geworden war, um erneut in ordentlichen Bahnen um den Rest seiner selbst gewickelt zu werden. Es schien fast als wäre meiner Hoffnung statt gegeben worden. Es gab das Geschehene einfach nicht mehr.
Ich denke oft, dass ich enttäuscht gewesen sein müsste. Insgeheim war ich jedoch erleichtert. Ich hätte das angerichtete Chaos nie wieder in seine angedachte Ordnung bringen können. Tief in meinem Herzen wusste ich, dass es so kommen würde. Die Hände meiner Mutter sahen angestrengt aus, dabei ergoss sich die Arbeit von Wochen in nur wenigen Minuten mit Leichtigkeit durch ihre Finger. Runde um Runde, wickelte sie den ganzen Faden ab. Ich traute mich nicht in ihr Gesicht zu schauen. Denn es tat mir leid, dass ich mir die Zeit mit ihr erschlichen hatte, deren Wert sich für sie gerade vor unserer beiden Augen in Nichts auflöste. Sie tat mir leid, weil ich wusste, wie gern sie es voller Stolz mit eingepackt hätte, nachdem sie bei jedem sonntäglichen Telefonat mit meiner Oma von meinem Talent berichtete, welches genau genommen keines war. Es war lediglich Fleiß, Konzentration und Zeit. Ehrlich gesagt, war meine eigene fehlende Enttäuschung über die Fehler, die meiner Mutter das Herz schwer machten, das was am zweitschwersten zu ertragende. Dass es mir egal war. Dass ich dem Verlust meiner Anstrengung gegenüber nichts empfand.
Am Ende des losen Fadens, schickte sie mich auf mein Zimmer. „Es ist am besten, wenn ich das mache“, sagte sie und legte das wieder fein säuberlich gefaltete Deckchen nebst garn in ihren Handarbeitskorb. Ich konnte gehen. Schluss mit der Aufmerksamkeit. Schluss mit dem Dabeisein.
Jahre sind vergangen, in denen ich davon geprägt immer und immer wieder mein Bestes gab für Anerkennung, Aufmerksamkeit und letztlich Vergebung. Dafür, dass ich nicht so war wie gedacht. Dafür, dass es mir nicht ebenso wichtig war wie ihr. Dafür, dass ich sie nicht davor bewahren konnte, das Deckchen Abend um Abend selbst fertig zu stellen, um ihr Gesicht zu wahren, für eine Sache, die letzten Endes total belanglos war. Meine Oma ist bereits vor vielen Jahren gestorben. Ich weiß nicht einmal, ob ihr dieses Deckchen etwas bedeutete, ob sie wirklich glaubte, ich habe es gemacht, ob es nach der Auflösung ihrer Habseligkeiten vielleicht einfach weggeschmissen wurde.
Doch ich weiß noch, wie ich am selben Abend nach oben in mein Zimmer ging. Das ausgebliebene Donnerwetter tobte in mir. In mir eine große Machtlosigkeit und so viele Worte. So viele Gedanken, so viele Gespräche, die ich gern geführt hätte. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte etwas sei falsch mit mir. Wie ich dachte, ich sei keine gute Tochter. Wie ich dachte, ich sei keine gute Enkelin. Wie ich dachte, dass es doch wichtig sei Dinge zu tun, die mir nicht entsprachen, wenn sie dafür jemand anderen glücklich machten. Wie ich still und leise entschied, dass es nicht richtig war andere zu enttäuschen.
Heute sitze ich da und habe den Faden wieder in der Hand. Ich bin verantwortlich dafür, was ich denke, glaube und mich zu hofen getraue. Aus dem endlosen Fluss eines Fadens kann ich gestalten was immer ich für richtig halte. Ich kann mich dafür entscheiden, dass die vielen Gedanken, Gefühle und Worte in mir einen Wert haben. Nicht für jeden. Nicht einmal für alle, von denen es sich mein verletzliches Ego wünschen würde. Doch für mich haben sie es. Weil ich das bin. Die, die Gefühle sehen kann, ihnen Namen und Worte geben kann, um mit ihnen und durch sie die Perspektive zu wechseln und Verantwortung zu übernehmen. Für mich selbst. Fehlerhaft und liebenswert.